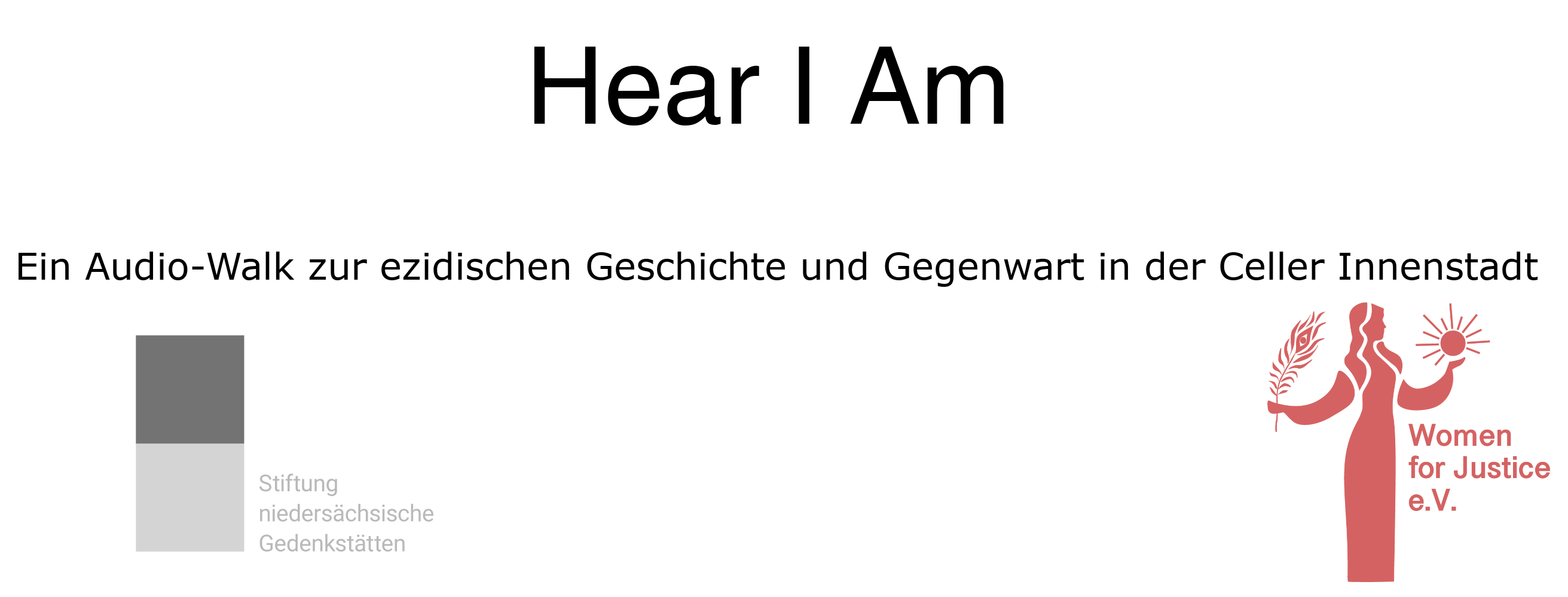Wege nach Celle
Transkript Interviewausschnitt: Hatti Kizilyel
!Bearbeitetes O-Ton Transkript!
Es war halt so, ich glaube, das müsste Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre gewesen sein, dass Deutschland im Ausland sehr geworben hat, um ausländische Kräfte. Es gab viel Arbeit und es waren zu wenig Leute da, die gearbeitet haben. Dann war es so, dass natürlich erst mal die europäischen Staaten abgerufen worden sind. Ob das jetzt die Spanier oder Italiener waren, es sind ja sehr viele Italiener in Wolfsburg, zum Beispiel bei VW. Und als man gemerkt hat, dass es nicht reicht und es immer noch Leute – frische Kräfte – braucht, hat man gesagt: „Gut, dann gucken wir mal in den orientalischen Raum.“ Da war die Türkei natürlich ein Land, das extrem viel Leute hatte, die auch, sage ich mal, wahrscheinlich den Wunsch hatten, dass sie mal irgendwann aus sehr ärmlichen Verhältnissen rauskommen. Man muss dazu sagen – und das ist teilweise heute immer noch so – dass in der Türkei Leute, die sehr arm sind auch arm bleiben. Es war so, dass die Menschen, ob aufgrund der Armut in ihrem Land und gerade auch bei uns in Ostanatolien, in dem kurdischsprachigen Raum, in dem kurdischen Gebiet, dass die Menschen dort in einer unvorstellbaren Armut aufgewachsen sind, in unvorstellbarer Entbehrung. Und dann kam dieser Ruf aus dem Westen, aus Deutschland speziell, man hat gesagt: „Hier brauchen wir frische Arbeitskräfte, hier gibt es gutes Geld.“
Dann sind natürlich die ersten gekommen und mein Vater gehörte zu einer der ersten ezidischen Familien in Celle. Ich erinnere mich ganz vage, ich bin hier geboren und jetzt im Nachhinein würde ich es in meiner Familie so ein bisschen wie mit einem Auffanglager vergleichen. Also bei uns war es immer so, dass wir überdurchschnittlich viel Besuch hatten. Es war nicht nur so, dass man mal eine Familie hatte. Nee, mein Vater ist mit seiner Familie angekommen, das bedeutete natürlich, dass alle Leute, die mit ihm in Verbindung standen und mit ihm in Anatolien Kontakt hatten, gesagt haben: „Wie ist es denn bei euch in Celle, gefällt es euch da? Ist es schön? Gibt es hier Arbeit? Können wir auch kommen?“ Wenn sie dann kamen, war das nicht so strukturiert wie heute, dass man Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtenden zum Beispiel, auch Wirtschaftsflüchtlingen, dass man denen Angebote macht und denen ein bisschen unter die Arme greift. Nee, damals war es so, dass die, die hier waren, sie aufgenommen haben.
Und bei uns waren Pi mal Daumen immer um die 20 Leute. In einer Dreizimmerwohnung. Die lagen auf den Fluren, auf Matratzen – ja gut, das war eine andere Zeit. Das war eine Zeit der Entbehrung. Und der Grundgedanke war ja auch immer, dass man gesagt hat: „Wir machen das mal für ein paar Jahre, verdienen bisschen Geld. Das Geld reicht dann drüben dafür, dass wir uns ein kleines Häuschen kaufen können, unseren Bauernhof bewirtschaften und für viele andere Sachen.“ Natürlich haben die ein paar Sachen nicht einkalkuliert, zum Beispiel, dass Kinder, die hier geboren werden, hier auch groß werden und dann zur Schule gehen. Und im Großen und Ganzen gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man sagt: „Da drüben ist es schön und wir machen da Urlaub“ – aber heimisch sind die meisten hier.
Bearbeitungshinweis: In Fällen, in denen im mündlichen Interview das generische Maskulinum verwendet wurde, haben wir uns entschieden, in der bearbeiteten Textversion die Schreibweise mit einem Unterstrich zu verwenden. Dies soll verdeutlichen, dass Menschen aller Geschlechter gemeint sind.