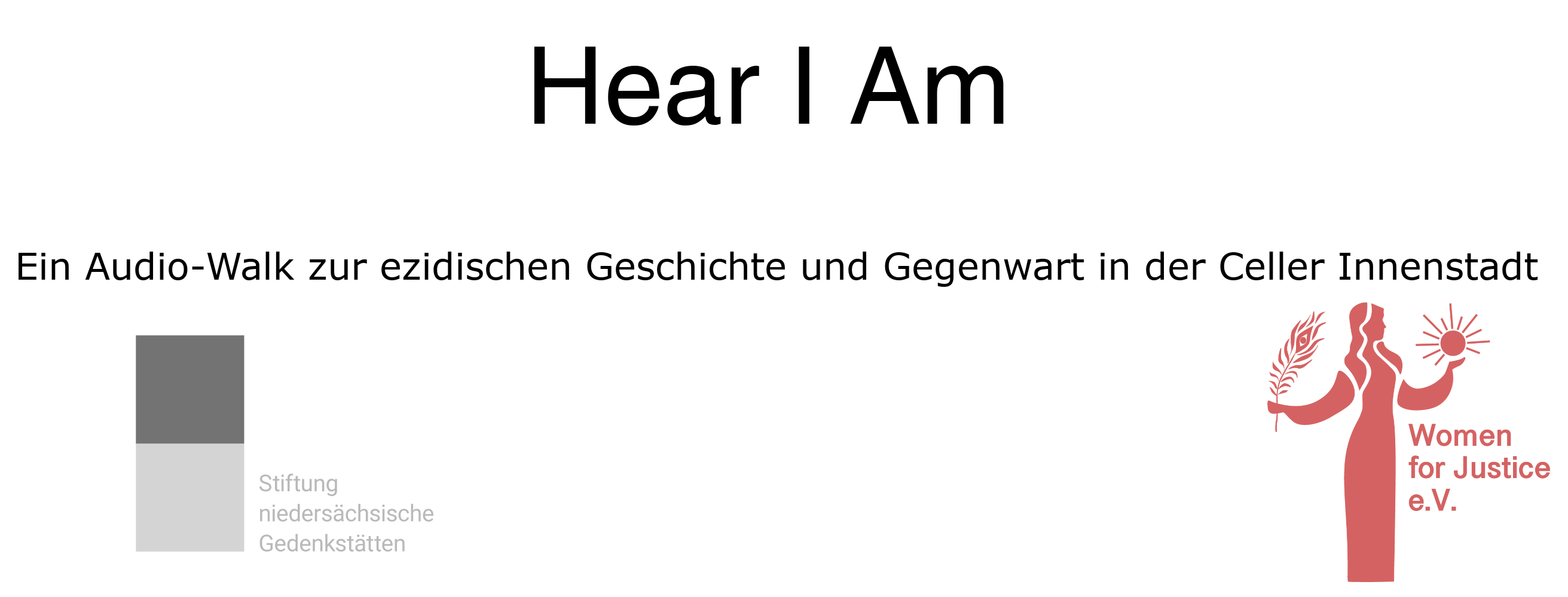Das virtuelle Kalifat
Medienstrategie des IS: Das virtuelle Kalifat
von Anne Raith 11.11.2016
Der Artikel «Medienstrategie des IS: Das virtuelle Kalifat» von Anne Raith, erschienen am 11.11.2016 über Deutschlandfunk, beschäftigt sich mit dem Medienumgang und -einsatz des Islamischen Staats.
Die Terrormiliz «Islamischer Staat» greift zur Organisation auf verschiedenste Medien zurück. Der Einsatz dieser Medien dient vor allem dem Zweck, neue Kämpfer zu rekrutieren, zur Vernetzung oder, um erfolgreiche Anschläge zu feiern. So spielten die Medien auch beim französischen Anschlag vom 13. November 2015 eine Rolle, bei welchem bereits Tage zuvor Hinweise im Magazin «Dabiq» sowie der Film «Paris ist zusammengebrochen» erschienen, in welchem erzählt wird, Frankreich hätte den Krieg gegen den IS gestartet und müsste nun dafür bezahlen.
Das Medienimperium des IS umfasst sowohl jenes Magazin als auch den Radiosender Al-Bayan oder das Al-Hayad Media Center sowie die globalen sozialen Medien Telegram oder Twitter, auf welchen auch im Nachhinein Videos und Bilder des Terrors des Paris-Anschlages erschienen.
«Terrorismus ist immer auch eine Kommunikationsstrategie», schreibt hierzu Politik- und Islamwissenschaftler Marwan Abou-Taam, «Wenn er [der Terrorist] sich mitteilen kann, gewinnt er tatsächlich». Terroristische Organisationen leben also von strategischer Kommunikation, mittels welcher auch der IS um Anhänger wirbt. Der Grund, warum diese Kommunikation auf Resonanz stößt, sind die Opfernarrative, die der IS aufstellt: Muslime würden auf der ganzen Welt unterdrückt, die dschihadistische Gewalt sei dementsprechend nur eine legitime Notwehr. Anklang findet das vor allem bei jungen Menschen, Kriminellen und jenen, die Diskriminierung erfahren, und anschließend in den Statuten des IS eine Sinnhaftigkeit finden. Der IS setzt hier gezielte Mittel ein, wie die Produktion von Rekrutierungsvideos, die jenen der amerikanischen Armee ähneln, oder «Anaschid», der einzig erlaubten Form von Musik im IS, die sehr ohrwurmartig, kurz und einschlägig ist. Die Propaganda des IS funktioniert vor allem über plakative, kurze und schnell zugängliche Botschaften, statt über rationale Überzeugung. Er entwickelt darüber eine Erlebnis- und Mitmachkultur, in der alle Ausgegrenzten Zuflucht finden und für ihre Auffassung einer fairen Welt kämpfen können. Trotzdem braucht der IS auch außerhalb der digitalen Welt sogenannte «Anwerber», die persönlichen Ansprechpartner und Organisatoren, die sozusagen Vernetzungspunkte des IS darstellen. Auch Frauen funktionieren oft als Anwerberinnen, indem sie ihren Männern erzählen, sie würden sie nur heiraten, wenn sie für den IS kämpfen.
Mittels der Rekrutierung über die sozialen Medien käme es zudem häufiger zu sogenannten «ferngesteuerten Einzeltätern», die laut Deutschem Verfassungsschutz besonders gefährlich werden können.
Die demokratischen Staaten sind im Kampf gegen den Medienmissbrauch des IS fast machtlos. Sie können zwar präventiv vorgehen, jedoch werden Kampagnen schnell unglaubwürdig, verstärken bestehende Stereotype und Vorurteile oder spielen gar dem IS in die Karten, indem sie mehr Aufmerksamkeit generieren. Zudem können die Social Media Plattformen Accounts und Inhalte sperren und löschen, doch daraufhin folgen schnell neue Konten. Was getan werden kann, ist das Medien nicht weiter zur Heroisierung der Täter beitragen, indem sie keine Fotos und den vollen Namen der Täter veröffentlichen. Essenziell sind jedoch eine gezielte Aufklärung und die Übermittlung eines richtigen Umgangs mit den Medien. Denn wichtiger, als die Medien an sich, ist der richtige Umgang mit diesen. Der Schlüssel zur Bekämpfung der IS-Propaganda sind die Festigung der Jugendlichen in ihrer demokratischen Identität und ein verstärkter Fokus auf die Menschen, die sich von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen. Statt auf die Täter, sollte sich auf die Umworbenen bzw. die potenziellen Umworbenen konzentriert werden.
Bearbeitungshinweis: In Fällen, in denen im mündlichen Interview das generische Maskulinum verwendet wurde, haben wir uns entschieden, in der bearbeiteten Textversion die Schreibweise mit einem Unterstrich zu verwenden. Dies soll verdeutlichen, dass Menschen aller Geschlechter gemeint sind.