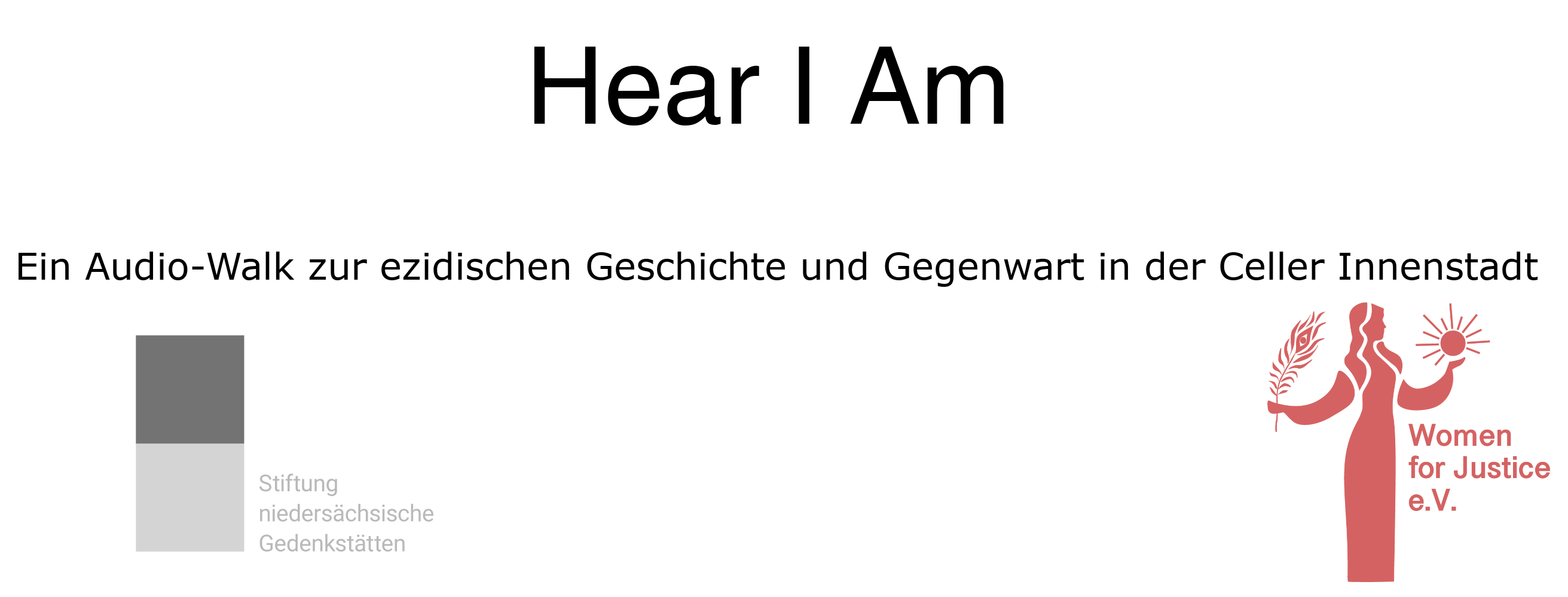Aufwachsen zwischen zwei Kulturen
Transkript Interviewausschnitt: Hatti’s Geschichte
!Bearbeitetes O-Ton Transkript!
Ich bin hier geboren worden, hab dann meine ersten Lebensjahre, war es so, dass meine Familie, meine Mutter, mein Vater mussten arbeiten. Mussten halt die Familie ernähren und da war es so, dass dann auch niemand für mich da war, der hätte auf mich aufpassen können. Also hat man gesagt: gut, alles klar, da ist eine deutsche Familie und die hat sich bereit erklärt, den kleinen Hatti damals aufzunehmen. Und ja aus dieser kleinen Eingewöhnungsphase oder Überbrückungsphase sind dann 7-8 Jahre geworden, also ich hab 7-8 Jahre bei einer deutschen Familie gelebt. Meine Oma war, ja gut, das war eine andere Liga. Die war Vertriebene aus Ostpreußen und war ja auch geflüchtet und im Grunde genommen war ich, glaube ich, das einzige kurdische Kind, vielleicht bin ich auch der einzige Kurde, der preußisch erzogen worden ist.
Also, da war noch Zucht und Ordnung, aber es war alles sehr gut und schön strukturiert auch. Für mich war das dann halt so, als ich dann irgendwann nach Hause kam. Ich sollte schon viel früher nach Hause und dann haben die gemerkt, dass ich krank geworden bin, weil ich mit dieser Kultur… also das ich praktisch von der einen Kultur… aus diesem netten, deutschen Haushalt bin ich ja herausgekommen, in meine kurdische Familie und der Schock war so groß, dass ich dann mich wahrscheinlich innerlich gesträubt habe. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Ich habe das Essen nicht gegessen. Ich kannte ja so Leckereien, wie paniertes Schweineschnitzel. Muss man nicht mögen, aber als Kind findest du es natürlich ziemlich cool. Und dann kommst du nach Hause und dann gibt es Sachen, die ich sehr fremd fand, die ich nicht essen wollte und konnte. Bin krank geworden. Dann haben sie gesagt, weißt du was, dem geht es bei seiner deutschen Familie, glaube ich, doch besser und dann bin ich wieder zurück.
Ich war dort natürlich also, in Anführungsstrichen, „Einzelkind“, da hast du ne andere Voraussetzungen gehabt. Es gab zum Beispiel auch eine Struktur und deswegen lege ich so unwahrscheinlich großen Wert darauf, dass man Bildungschancen für alle Menschen gleich gestaltet, für alle Kinder gleich gestaltet, unabhängig vom sozialen Background. Weil, auf der einen Seite war ich in der Schule, als ich klein war, in meiner deutschen Pflegefamilien. Da gab es eine Struktur. Du kamst nach der Schule nach Hause, hast Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht, Mittagsschlaf. Irgendwann war es dann so, dass du noch spielen durftest und dann, obwohl 30, 35 Grad draußen waren, ging es ins Bett. In der kurdischen Familie war das aber so, diese Struktur fehlte mir, also habe ich natürlich, als ich dann nach Hause kam, weil dort niemand war, der gesagt hat: „Sag mal Hatti, wollen wir nochmal Hausaufgaben zusammen machen?“ oder „Ich lese mal Korrektur?“. Das gab es ja bei uns nicht, weil sie selber nicht so gut Deutsch gesprochen haben. Also das Bildungsniveau hat natürlich dann auch darunter gelitten und das hat man an den Noten auch gemerkt. Und deswegen weiß ich wie es ist, wenn man als Kind, zum Beispiel, auch nicht großen Wert darauf legt. Das man dann sagt: Na gut, wenn mich hier keiner kontrolliert und keiner macht mit mir die Hausaufgaben, dann mache ich sie einfach nicht. Und deswegen eine gesunde Struktur schadet nie und erhöht natürlich auch dann die Bildungschancen.
Also bis zum 15., 16. Lebensjahr habe ich mich einfach auch nicht auf Kurdisch unterhalten können. Ich hab‘s verstanden, aber gesprochen habe ich es nicht. Und wenn es jemand mit mir gesprochen hat, dann habe ich in der Regel auf Deutsch geantwortet. Also, ich kam sehr, sehr später dazu, Kurdisch zu sprechen. Mittlerweile würde ich sagen, ich bilde mir ein, dass ich es doch ganz gut beherrsche.
Es gab so Momente, an denen ich gemerkt hab, dass wir einen verschiedenen Kulturkreis haben, aber als Kind nimmst du das nicht so richtig wahr. Es gab mal so ein Erlebnis, das war ganz witzig eigentlich. Da komme ich wieder auf das panierte Schweinekotelett. Da bin ich nämlich nach Hause gekommen und da hat meine Familie, meine kurdische, ezidische, versucht mir zu vermitteln, dass Schweinefleisch nicht so toll ist. Das ist halt so ein religiöses Ding. Und dann bin ich dann mit meinem neuen Wissen zu meiner Oma gegangen und hab der dann gesagt, meiner deutschen Pflegeoma, hab dann gesagt: „Oma, ich esse jetzt kein Schweinefleisch mehr!“ Und dann hat sie gesagt: „Alles klar, dann mach dir ein Brot.“ Das war so ihre kurze Antwort. Sie war, wie gesagt etwas stoisch, preußisch. und dann hab ich sie gefragt, „was macht ihr euch denn schönes?“ und dann sagt sie: „Paniertes Schweinekotelett.“ Und da habe ich dann gesagt, dass ich kein Brot will. Und das waren so die ersten Berührungen, bei denen man gemerkt hat: oh, wir sind ja doch irgendwie so ein bisschen im religiösen Sinne auseinander.
Ich habe spät, relativ spät erst auch viele Strukturen, Mechanismen aufgenommen, aber ich würde es eher als als ein, ein Vorteil für mich auch sehen, weil ich einfach auch in beiden Kulturen und Gesellschaften mich gut zurechtfinde und auch in beiden Zuhause bin. Und viele profitiert davon nicht. Da sie immer noch so Berührungsängste haben, vor dem anderen. Es gibt viele gute Sachen in beiden Kulturkreisen und ich hab mit Lokalpolitik angefangen oder Kommunalpolitik, weil ich einfach auch so ein Bindeglied zwischen den Kulturen sein möchte, weil ich auf der einen Seite genau weiß, wie es in der kurdischen Struktur ist, die für den Deutschen nicht unbedingt einfach ist einzusehen und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Kurden vielleicht bei dem deutschen etwas fremdeln. Menschen, wir wissen auch nicht, wie die ticken, aber ich weiß, wie die ticken, weil ich bin einer von ihnen. Von beiden Seiten und ja, das ist glaube ich so dann der Punkt, an dem man sagt, ganz ehrlich, wenn du in beiden Kulturen aufgewachsen bist und beides kennst, warum machst du daraus nicht etwas und versuchst halt dann der Gesellschaft so ein bisschen was davon zurückzugeben? Dass jeder den anderen wertschätzen kann, irgendwann mal.
Ja, zum Laden bin ich gekommen, weil es einfach ein Familienbetrieb war und irgendwann machst du mit. Du bist dann dabei, dann kommst du nach der Schule, machst dann irgendwas und bist dann immer mehr Teil des Ganzen und wenn es dir gefällt und du dann sagts, Mensch, dass könnte ich mir vorstelle, für die Zukunft auch, dann machst du es. Ich sehe den Laden jetzt nicht nur aus dem Sinne des Geschäftsführers oder dass ich da einfach auch Gewinne erwirtschafte. Nein, es geht mir auch da wieder darum, dass ich sage, er ist einfach ein Teil dieser celler Innenstadt geworden und das macht auch die Mitarbeiter stolz, das macht auch mich sehr stolz, dass man einfach sagt, da gehen wir hin, weil wir uns wohl fühlen und das war für mich schon immer die Hauptintention, also unabhängig von allem anderen, dass man einfach sagt, der gehört dazu. Vielleicht ist es auch so, dieses Gefühl, dass man einen Job, wenn man ihn gut macht und auch wirklich sich Mühe gibt und auch von den Kunden das Feedback bekommt, dass es ihnen auch gefällt, das ist ja einfach die Hauptintention dafür, dass du einen Laden als Familienbetrieb 20 Jahre machst.
Irgendwann kam halt die Cellesche Zeitung und hat gesagt: Menschen hör zu. Wir haben da eine ganz tolle Idee mit neuem Format, das nennen wir dann einfach Hattis Woche. Hast du Lust mitzumachen und da habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Ist mal eine Idee wert und dann haben wir gemerkt, nach den ersten Folgen, die wir gedreht haben, das kommt eigentlich ganz gut an und ich hab noch was gemerkt, dass ich, obwohl ich Celler bin, gebürtiger Celler bin, oft auch gar nicht alles kenne. Also wir haben Folgen gedreht, zum Beispiel, da ging es um den celler Kirchturmbläser, dann sind wir mit Kinder zum Wasalauf in der Vorbereitung gelaufen und ich hab gemerkt, dass Siebenjährige einfach von der Kondition besser sind als ich. Wir haben, ich glaube, sogar über 100 Folgen gedreht. Jeden Freitag, unter Bedingungen manchmal die waren nicht so prall, aber wir haben es trotzdem durchgezogen und das war schön. Das hat Spaß gemacht.
Ich hab natürlich im Vorfeld auch schon kommunalpolitisch schon ein bisschen mich dafür interessiert und bin dann irgendwann in den Kreistag gekommen und über den Kreistag bin ich jetzt auch in den Stadtrat bekommen und sitze praktisch in beiden Parlamenten. Stadt und Kreistag und Ortsrat natürlich. Und der Ortsrat ist auch so, das sind dann die Belange, die direkt vor deiner Haustür sind und deshalb würde ich mir wünschen das ganz, ganz, viele Leute, die ganz oben sind, in der Bundespolitik vielleicht mal einfach wieder Basic Arbeit machen und sagen, wir machen den Ortsrat, damit sie wissen, wie die Leute ticken, vor ihrer eigenen Haustür. Mann sagt ja immer, „die da oben“ und so. Es ist schwieriger, aber wenn du im Ortsrat bist, dann weißt du auch ganz genau, von deinem Nachbarn, die Hecke ist zu hoch, da musst du mal handeln.
Bearbeitungshinweis: In Fällen, in denen im mündlichen Interview das generische Maskulinum verwendet wurde, haben wir uns entschieden, in der bearbeiteten Textversion die Schreibweise mit einem Unterstrich zu verwenden. Dies soll verdeutlichen, dass Menschen aller Geschlechter gemeint sind.